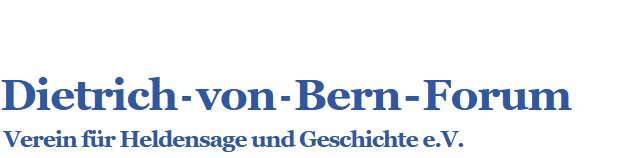|
William Wright’s und Carl Sagan’s Axiom
von Rolf Badenhausen
Die
„universalwissenschaftliche“ und bis ins Philosophische reichende
Aussage
Absence
of evidence is not the evidence [of absence],
soweit sie vom
irischen Missionar und Ethnologen William Wright stammen und von den
Kosmologen Martin Rees und Carl Sagan gepflegt worden sein soll, hat
für uns einen besonderen Stellenwert. Denn für unsere
Geschichtsforschung gelangen wir mit dieser Art von Postulat zur
Folgerung, dass „das Fehlen eines
Beweises für ein postuliertes faktisches Ereignis nicht der Beweis
dafür ist, dass es nie eingetreten sein konnte“.
Mit „Fehlen“, zuweilen berechtigt gleichgesetzt mit
„Versäumnis“ oder
„Verlust“, erhebt sich zugleich der literarische Problemkreis, mit dem
Heinz Ritter-Schaumburg konfrontiert wurde.
Allerdings ist das viel kolportierte Axiom (Sagan)
tiefgründiger als es
auf den ersten Blick scheint:
Anstelle eines trefflich bündigeren „missing
evidence“ ist darin von „Abwesenheit“ eines geforderten
Nachweises die Rede, die nach meinem Verständnis eine wann, wo, wie
auch immer mögliche Existenz impliziert.
Punktum: Daraus folgt ad hoc die funktionelle
Bestimmung und
publizistische Aufgabe unseres Vereins und Forums in Form dieser
‚quaestio cardinalis‘:
Darf
nur das geschehen sein, was aus unseren eklatant lückenhaft
vorliegenden frühzeitlichen Überlieferungen – aus zum Teil kaum
belastbaren chronistischen Verschriftlichungen – aufs
geschichtsfaktische Podest erhoben wurde?
Und hierzu
längst
Heinz Ritter, denn nach mehrheitlicher Auffassung von Forschung und
Lehre dürfen „nordwärts ziehende Nibelungen“ und ein auf Theoderich d.
Gr. pseudologisch verklärter, nach textanalytischem Belieben
widersprüchlich behandelter Dietrich/Thidrek dieses Podium nicht
erreichen. Denn wider den Angaben in den Textzeugnissen wollen ihn
Germanistik und Nordistik ins italienische Milieu entführen, den
Quellenwert der Saga zum Niflungenzug allenfalls im Fahrwasser
nibelungischer Reimdichtung auftauchen sehen – unterstützt von kaum
mehr als programmatisch absegnenden Lektoraten ihrer Fachorgane[1].
Dagegen bedient sich die von Ritter angeregte
Privatforschung anderer Wertungsmaßstäbe, wie in diesem Heft Reinhold
A. Mainz. Er zählt zu den
Autoren unseres ersten Forschungsbands „Ein Niflungenreich in der Voreifel?“ –
darin
zur Genealogie des inluster vir
Nibelung in den Chroniken des sog. Fredegar – und widmet sich
hier der Frage, ob die Nibelungen aus diesem Raum stammen dürfen. Die
ihrem Zug bereits vorausgegangene fränkische Übernahme vom
rheinrömischen Machtzentrum Köln durchleuchtet Karl Weinand anhand von
spätantiken chronistischen Quellen.
Auch für diese Ausgabe hat uns der Themenkomplex
Bonn-Verona nicht
ruhen lassen. Dr. Pierantonio Braggio brachte im Veroneser Journal Verona Sette
einen Aufsatz über die Bonner Säule „Steinernes Wölfchen“ – hier in
deutscher Übersetzung und mit weiteren Details zur Geschichte dieses
Monuments ergänzt.
Zwei weitere Beiträge befassen sich mit dem
ortsgeschichtlichen Umfeld
des bereits von Ulrich Steffens aufgeworfenen „Berny“ als
beinamentliche Memoria an einen wahrscheinlich dort aufgewachsenen
Theuderich I. Seiner ortsgeschichtlichen Kontextualisierung mit
Dietrich
von Bern wird hier nachgegangen. Im Zuge dessen führt uns weiteres
Sondieren – unweit von Chlodwigs Soissons – zu einem wenig südlich
gelegenen „Château Thierry“ – Dietrichs
Burg, übrigens an einer Siedlung, deren Geschichte bis in die
Augusteische Zeit zurückreicht. Diese Periode zählt auch zum
Forschungsbereich unseres Mitglieds Dr. Jürgen Wächter, der sich mit
seiner neuesten Publikation in die römisch-germanische Geschichte des
‚Hunalands‘ – ebenda zu den sog. Pontes
longi – begibt.
Wie schon in unserem Mai-Heft angekündigt folgen in
diesem Heft (S. 65–67) unsere Informationen zur diesjährigen
Jahreshauptversammlung und
Fachtagung, zu der Sie herzlich eingeladen sind.
_________________
[1] „Die
wissenschaftliche Qualität eines Beitrags hängt nicht vom
Publikationsorgan ab, in dem er öffentlich zugänglich gemacht wird.“
Eine DAI-Richtlinie „zur Sicherung
guter wissenschaftlicher Praxis,“ 01.06.2023. (DAI: Deutsches
Archäologisches Institut) 
|